GESUCHE VOM HERSTELLER CARL-ZEISS-JENA
Nivellier I

Baujahr ab 1909
Dieses Gerät zeichnete sich aus durch:
- ein kurzes Fernrohr mit Innenfokussierung,
verbessertem Okularauszug sowie einer Glasstrichplatte, die eine stabilere Ziellinie garantierte,
– eine wartungsarme zylindrische Stehachse,
– eine höhere Einspielgenauigkeit durch eine spezielle Prismenablesung der Röhrenlibelle,
– die Ablesegenauigkeit konnte durch einen Planplattenvorsatz gesteigert werden und
– das Gerät war klein und leicht
Nivellier III
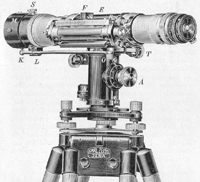
Baujahr ca. ab 1925
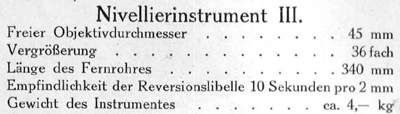
Nivellier A
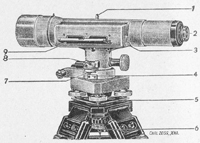
Baujahr ca. ab 1925
Mit dem Ni A konnte ein mittlerer Höhenmessfehler von +/- 0,4 mm auf einen Kilometer im Doppelnivellement reproduzierbar bestimmt werden.
Nivellier Ni 002 A

Baujahr ca. ab 1983
Unter Beibehaltung der bewährten
Grundprinzipien des
NI 002 wurde mit
der Entwicklung des NI 002 A eine weitere
Steigerung der Leistungsfähigkeit
beim Präzisionsnivellement erreicht.
Die Ziellinienstabilisierung mit quasiabsolutem
Horizont garantiert höchste
Präzision. Der konstruktiv verbesserte
Kompensator des
NI 002 A wird auch
erhöhten Ansprüchen an das Schwingungsverhalten und die Magnetfreiheit
gerecht.
Nivellier RENI 002 A

Baujahr ca. ab 1988
Zwölf verschiedene Nivellementsverfahren
-
zehn für das Linien- und zwei
für das Flächennivellement - sind im
RENI 002 A programmiert.
Elektrooptischer Distanzmesser EOS
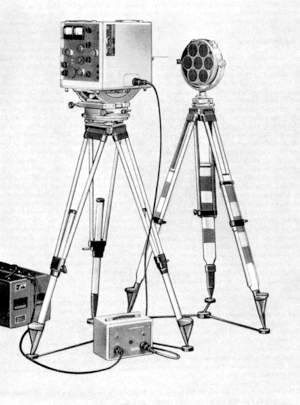
Baujahr ca. ab 1965
Auf Basis des bekannten Phasendifferenzmessverfahrens
erschien 1965 der erste elektrooptische Distanzmesser
EOS aus Jena. Der aus Uppsala/Schweden stammende Erik Bergstrand hatte bereits 1948 erste Versuche hierzu durchgeführt. Mit dem EOS wurde auf eine Entfernung von
2 km eine Streckenmessgenauigkeit von +/-1 cm erreicht. Jedoch das Gewicht von 34 kg und die Leistungsaufnahme von 70 W machen deutlich, dass es sich hierbei nicht um ein wirklich portables Gerät handelt. Auch ist die Größe des Instrumentes noch nicht für eine Kombination mit einem Theodoliten geeignet, um ein Tachymeter bzw. eine Totalstation zu bauen.
Elektrooptischer Tachymeter EOT-S

Baujahr ca. ab 1979
Mit dem EOT-S wurde 1979 das erste Tachymeter aus
Jena mit automatischer digitaler Streckenmessung, einer
digitalen absoluten Winkelmessung sowie speziellen Programmen zur Sportmessung vorgestellt. Dieses Gerät
wurde 1980 bei den Olympischen Spielen in Moskau erstmals
erfolgreich für die Sportmessung bei verschiedenen
Disziplinen eingesetzt.
Tachymeterautomat RECOTA

Baujahr ca. ab 1980
Bei dem RECOTA handelt es sich um ein mit einem Mikrocomputer erweitertem RETA, welches mittels internen geodätischen Rechenprogrammen Koordinateninformationen bereits im Felde erzeugt.
Registrierendes Tachymeter
RETA 3A

Baujahr ca. ab 1989
Die 1989 vorgestellten Tachymeter RETA 3A und RETA 20A waren die letzten unter DDR-Verhältnissen in Jena entwickelten Geräte. Die Streckenmessgenauigkeit lag bei 3…4 mm + 2 ppm * D und dieWinkelmessgenauigkeit betrug 3" bzw. 1". Die Miniaturisierung war vorangeschritten, sodass das Gewicht auf 7,0 kg bzw. 7,2 kg reduziert werden konnte. Mitgeliefert wurden umfangreiche Berechnungsprogramme, die auch eine automatische
Korrektur der Messdaten im Feld ermöglichten.
Phototheodolit Photeo 19/1318
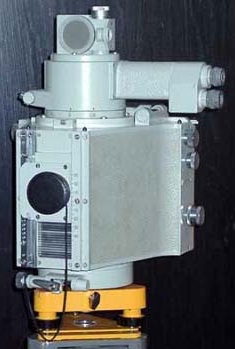
Baujahr ca. ab 1950 ?
Terrestrisch- photogrammetrisches Aufnahmegerät für die Anfertigung von Messbildern zur Herstellung von topographischen Karten und Katasterkarten, technischen Plänen für den Bau von Verkehrslinien, Talsperren usw. sowie zur Durchführung von Architekturvermessungen.
Redta I, II und III

Baujahr ca. ab 1932
Im Jahr 1922 begann die Entwicklung optischer Tachymeter
in Jena, nachdem die Firma Carl Zeiss die Patente des
schweizerischen Grundbuchgeometers R. Bosshardt und
des norwegischen Ingenieurs I. Dahl erworben hatte.
Tachymeter ermöglichen neben der Winkelmessung in
Hz und V, wie wir es von Theodoliten her kennen, zusätzlich
eine Distanzmessung zum jeweiligen Zielobjekt.
Im Mai 1925 wird das Redta I nach dem Prinzip von
Bosshardt vorgestellt, von dem es bis zum 2.Weltkrieg
noch zwei Weiterentwicklungen gab – das Redta II
(1932) -links im Bild zu sehen- und das Redta III (1937).
Repetitionstheodolit RTh I

Baujahr ca. ab 1924
Ein wichtiger technologischer Sprung wurde mit dem
1924 vorgestellten ersten optischen Theodoliten Th I erreicht. Er vereinigte alle wesentlichen Merkmale
eines modernen Vermessungsgerätes dieser Art:
– Glasteilkreise für die Horizontal- und Vertikalwinkelbestimmung,
– eine diametrale Kreisablesung mit Ablesemikroskopen,
die Exzentrizitätsfehler eliminierte,
– eine geschlossene Bauweise sowie
– eine U-förmige Theodolitstütze.
Astronomischer Theodolit
Theo 002
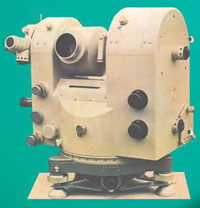
Baujahr ca. ab 1965
Neben den Serieninstrumenten, die in hohen Stückzahlen
produziert wurden, gab es auch Spezialausführungen von
Theodoliten, wie den astronomischen Theodolit Theo 002
aus dem Jahre 1965. Dieser Präzisionstheodolit
diente u.a. astronomischen Anschlussmessungen.
Einige technische Besonderheiten waren:
– ein Neigungskompensator zur Stabilisierung des Höhenindex,
– ein weiterer Neigungskompensator zur Stabilisierung
der Ziellinie des Fernrohres,
– die Teilkreisablesung mit einer Genauigkeit von 0,1".
Theodolit Theo 015 B

Baujahr ca. ab 1980
Besonderheiten
der Theodolitreihe B waren:
– Für die Einzelteil- und die Komponentenfertigung wurden
Taktstraßen errichtet, mit denen eine sehr gute
Wirtschaftlichkeit bei großen Stückzahlen erzielt wurde.
– Koaxial angeordnete Klemmen und Feintriebe garantierten
dem Anwender eine einfache und gute Bedienung.
– Die wartungsfreie und hochgenaue halbkinematische
Stehachse verminderte den Taumelfehler
drastisch, dadurch konnte auf eine Reiterlibelle verzichtet
werden.
– Koaxial angeordnete Grob-und
Fein-Kreiseinstellung
– Die automatische Stabilisierung des Höhenindex des
Vertikalkreises durch einen robusten Neigungskompensator brachte eine erhebliche Produktivitätssteigerung bei den Anwendern.